-
 #Cannes Lions Festival
Das sind die deutschen Young Lions 2024 Der deutsche Cannes Lions Festivalrepräsentant Weischer entsendet 12 junge Talente …
#Cannes Lions Festival
Das sind die deutschen Young Lions 2024 Der deutsche Cannes Lions Festivalrepräsentant Weischer entsendet 12 junge Talente …
-
 #Kinowerbung
The Big Outdoor Die Abende werden länger und wärmer. Der Sommer kündigt sich …
#Kinowerbung
The Big Outdoor Die Abende werden länger und wärmer. Der Sommer kündigt sich …
-
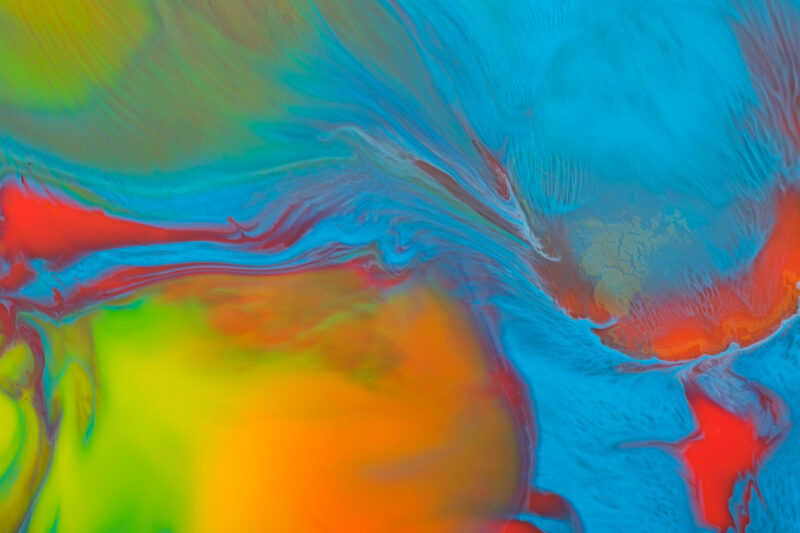 #Cannes Lions Festival
Deutsche Cannes Lions Juror:innen 2024 Die deutschen Awarding Juror:innen des Cannes Lions Festivals stehen fest. …
#Cannes Lions Festival
Deutsche Cannes Lions Juror:innen 2024 Die deutschen Awarding Juror:innen des Cannes Lions Festivals stehen fest. …
-
 #Social Media #Corporate News
Weischer gründet Social Media Agentur Mit Weischer.Connect zählt ab sofort auch eine Social Media Agentur zur Unternehmensgruppe. Neuer CEO ist Björn Wenzel.
#Social Media #Corporate News
Weischer gründet Social Media Agentur Mit Weischer.Connect zählt ab sofort auch eine Social Media Agentur zur Unternehmensgruppe. Neuer CEO ist Björn Wenzel.
-
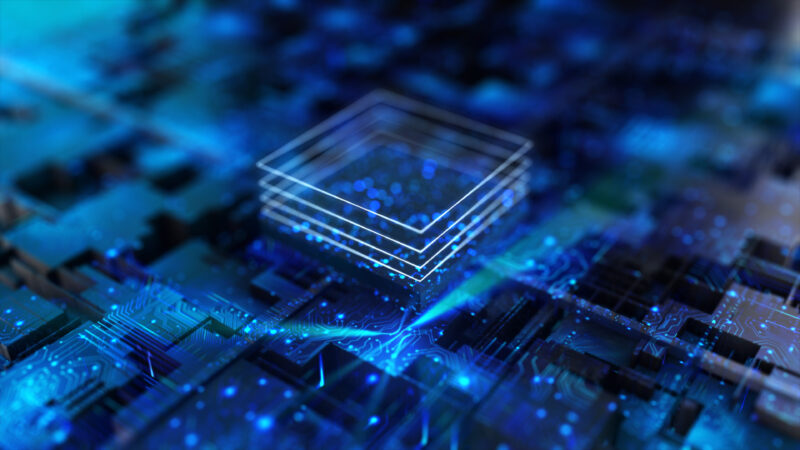 #Out-of-Home #Corporate News
Weischer.JvB inszeniert erste KI-Kampagne für Dolomiti Superski Weischer.JvB führt mit Dolomiti Superski die erste deutschlandweite DOOH-Kampagne mit KI-gesteuerter Zielgruppenanalyse und Motivausspielung ein.
#Out-of-Home #Corporate News
Weischer.JvB inszeniert erste KI-Kampagne für Dolomiti Superski Weischer.JvB führt mit Dolomiti Superski die erste deutschlandweite DOOH-Kampagne mit KI-gesteuerter Zielgruppenanalyse und Motivausspielung ein.
-
 #Kinowerbung
Kino ist das ganze Jahr Das Kinojahr 2024 wird für reichlich Abwechslung und Wiedersehensfreude sorgen.
#Kinowerbung
Kino ist das ganze Jahr Das Kinojahr 2024 wird für reichlich Abwechslung und Wiedersehensfreude sorgen.
-
 #Cannes Lions Festival
Young Lions Competition 2024 Bewerbungsphase gestartet Der Cannes Lions Festivalrepräsentant Weischer ist erneut auf der Suche …
#Cannes Lions Festival
Young Lions Competition 2024 Bewerbungsphase gestartet Der Cannes Lions Festivalrepräsentant Weischer ist erneut auf der Suche …
-
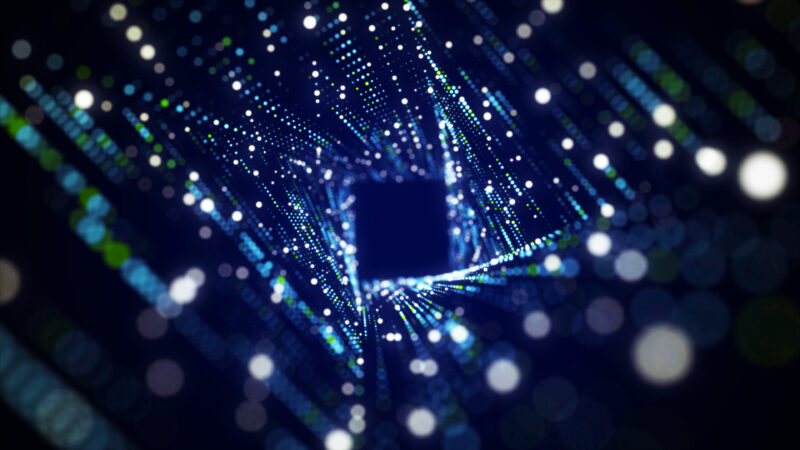 #Out-of-Home
Weischer.JvB führt in (D)OOH KI-basierte Kampagnenplanung ein Zäsur in der Planung von Außenwerbung: Weischer.JvB launcht ein KI-gestütztes …
#Out-of-Home
Weischer.JvB führt in (D)OOH KI-basierte Kampagnenplanung ein Zäsur in der Planung von Außenwerbung: Weischer.JvB launcht ein KI-gestütztes …
-
 #Corporate News #Verantwortung
Weischer – Neue Initiativen bei Nachhaltigkeit Das Medienunternehmen Weischer speist seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 über ein eigenes …
#Corporate News #Verantwortung
Weischer – Neue Initiativen bei Nachhaltigkeit Das Medienunternehmen Weischer speist seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 über ein eigenes …
-
 #Corporate News #Cannes Lions Festival
Nacht der Löwen 2023 in Hamburg Feierliche Preisverleihung für die besten Werber:innen Deutschlands: Das Hamburger Medienunternehmen …
#Corporate News #Cannes Lions Festival
Nacht der Löwen 2023 in Hamburg Feierliche Preisverleihung für die besten Werber:innen Deutschlands: Das Hamburger Medienunternehmen …
-
 #Corporate News #Kinowerbung
Die junge Zielgruppe feiert das Kino Noch nie haben Social Media-Trends das Besucherverhalten im Kino stärker …
#Corporate News #Kinowerbung
Die junge Zielgruppe feiert das Kino Noch nie haben Social Media-Trends das Besucherverhalten im Kino stärker …
-
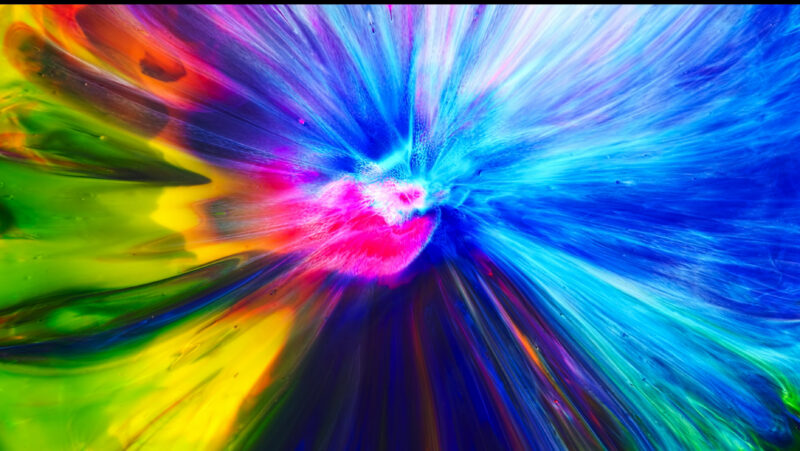 #Cannes Lions Festival
Das sind die deutsche Juror:innen der Eurobest 2023 Mit insgesamt 10 Jurymitglieder und zwei Jurypräsident:innen ist Deutschland wieder …
#Cannes Lions Festival
Das sind die deutsche Juror:innen der Eurobest 2023 Mit insgesamt 10 Jurymitglieder und zwei Jurypräsident:innen ist Deutschland wieder …
-
 #Corporate News #Kinowerbung
Weischer.Cinema zündet zweite Programmatic-Stufe Mit „Programmatic Flex Targeting“ können Zielgruppen im Kino jetzt auch …
#Corporate News #Kinowerbung
Weischer.Cinema zündet zweite Programmatic-Stufe Mit „Programmatic Flex Targeting“ können Zielgruppen im Kino jetzt auch …
-
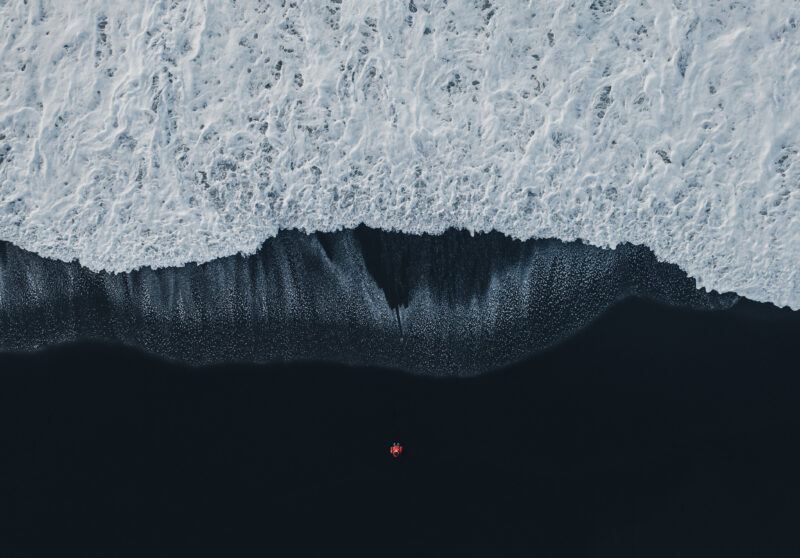 #Corporate News #Kinowerbung
Kino setzt ein Zeichen für Brand Safety Kinowerbung wird noch transparenter: Durch eine enge Kooperation des Kinowerbeverbands …
#Corporate News #Kinowerbung
Kino setzt ein Zeichen für Brand Safety Kinowerbung wird noch transparenter: Durch eine enge Kooperation des Kinowerbeverbands …
-
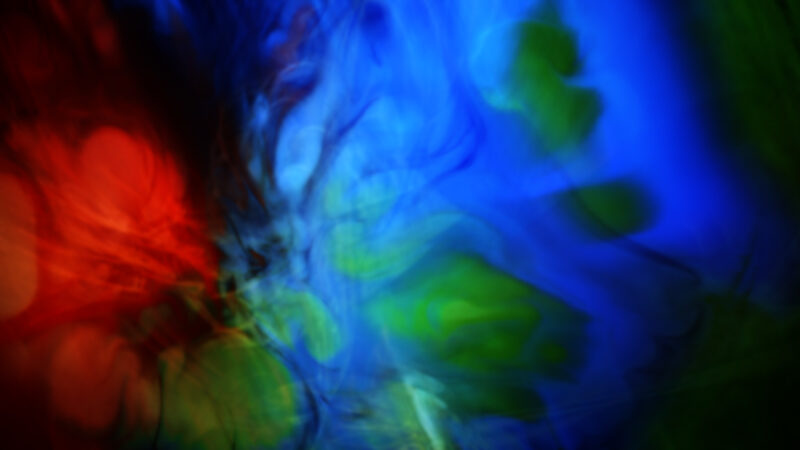 #Cannes Lions Festival
Deutsche Cannes Lions Juror:innen 2023 Das sind die 19 deutschen Juror:innen, die 2023 ihre Expertise in die Fachjurys des Cannes Lions Festival of Creativity einfließen lassen!
#Cannes Lions Festival
Deutsche Cannes Lions Juror:innen 2023 Das sind die 19 deutschen Juror:innen, die 2023 ihre Expertise in die Fachjurys des Cannes Lions Festival of Creativity einfließen lassen!
-
 #Wissen #Kinowerbung
KINO. MEIN ORT. Wie lassen sich Marken im Film und im Kino wirkungsvoll …
#Wissen #Kinowerbung
KINO. MEIN ORT. Wie lassen sich Marken im Film und im Kino wirkungsvoll …
-
 #Corporate News #Cannes Lions Festival
Bewerbungsphase Young Lions 2023 startet mit neuer Kategorie Young Lions Wettbewerb 2023 gestartet! Jetzt bewerben unter www.younglions.de für …
#Corporate News #Cannes Lions Festival
Bewerbungsphase Young Lions 2023 startet mit neuer Kategorie Young Lions Wettbewerb 2023 gestartet! Jetzt bewerben unter www.younglions.de für …
-
 #Corporate News
Stephanie Woesler wird neue Gesellschafterin bei Weischer Im Gesellschafterkreis verantwortet Stephanie Woesler seit dem 1. Januar die …
#Corporate News
Stephanie Woesler wird neue Gesellschafterin bei Weischer Im Gesellschafterkreis verantwortet Stephanie Woesler seit dem 1. Januar die …
-
 #Corporate News #Out-of-Home
Weischer will neue Geschäftsfelder erschließen Udo Schendel wird Chief Investment Officer (CIO). Die Rolle des …
#Corporate News #Out-of-Home
Weischer will neue Geschäftsfelder erschließen Udo Schendel wird Chief Investment Officer (CIO). Die Rolle des …
-
 #Corporate News #Kinowerbung
Cinedom in Köln: Völlig neue Erlebniswelten Der Cinedom in Köln wird zum Showcase der Kinowerbung: Marken …
#Corporate News #Kinowerbung
Cinedom in Köln: Völlig neue Erlebniswelten Der Cinedom in Köln wird zum Showcase der Kinowerbung: Marken …
-
 #Verantwortung
Global Week to #Act4SDGs – Weischer ist wieder dabei! Seit 2014 engagieren wir uns für die Sustainable Development Goals …
#Verantwortung
Global Week to #Act4SDGs – Weischer ist wieder dabei! Seit 2014 engagieren wir uns für die Sustainable Development Goals …
-
 #Cannes Lions Festival
Deutsche Juror:innen Eurobest 2022 stehen fest Insgesamt 10 deutsche Jurymitglieder ziehen dieses Jahr in die Eurobest …
#Cannes Lions Festival
Deutsche Juror:innen Eurobest 2022 stehen fest Insgesamt 10 deutsche Jurymitglieder ziehen dieses Jahr in die Eurobest …
-
 #Corporate News #Verantwortung
Nachhaltigkeitsbericht auf alten Werbeplakaten Weischer veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht. Das Besondere: Das graphisch aufwendig gestaltete …
#Corporate News #Verantwortung
Nachhaltigkeitsbericht auf alten Werbeplakaten Weischer veröffentlicht einen Nachhaltigkeitsbericht. Das Besondere: Das graphisch aufwendig gestaltete …
-
 #Corporate News #Out-of-Home
Kampagne gegen Obdachlosigkeit in Köln Weischer.JvB in Köln, Wall und die KreativRealisten initiieren gemeinsam eine …
#Corporate News #Out-of-Home
Kampagne gegen Obdachlosigkeit in Köln Weischer.JvB in Köln, Wall und die KreativRealisten initiieren gemeinsam eine …
-
 #Corporate News #Kinowerbung
“Leuchtspuren” werden fortgesetzt Die Kino-Initiative „Leuchtspuren“ hat sich zum Liebling der Kinogänger entwickelt. …
#Corporate News #Kinowerbung
“Leuchtspuren” werden fortgesetzt Die Kino-Initiative „Leuchtspuren“ hat sich zum Liebling der Kinogänger entwickelt. …